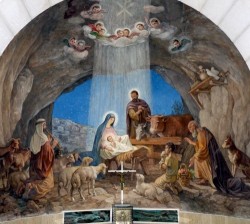Am Ostermontag hören wir im Evangelium immer den Bericht über die sogenannten „Emmausjünger“. Die beiden Jünger waren ganz offensichtlich in tiefer Traurigkeit von Jerusalem aufgebrochen. Sie hatten große Hoffnungen auf Jesus gesetzt, aber mit der Kreuzigung schien alles aus zu sein. Sie sind von Jerusalem (Stadt des Friedens) weggegangen, um sich anderswo Erleichterung und Trost zu verschaffen. Das wird durch die Worte ‚Emmaus‘ angedeutet: Es heißt übersetzt ‚warme Quelle‘.
Am Ostermontag hören wir im Evangelium immer den Bericht über die sogenannten „Emmausjünger“. Die beiden Jünger waren ganz offensichtlich in tiefer Traurigkeit von Jerusalem aufgebrochen. Sie hatten große Hoffnungen auf Jesus gesetzt, aber mit der Kreuzigung schien alles aus zu sein. Sie sind von Jerusalem (Stadt des Friedens) weggegangen, um sich anderswo Erleichterung und Trost zu verschaffen. Das wird durch die Worte ‚Emmaus‘ angedeutet: Es heißt übersetzt ‚warme Quelle‘.
Dieser ‚Emmausgang‘ ist hier ein Bild für unser geistliches Leben: Wenn das Kreuz über uns kommt, gewisse Mühen und Schwierigkeiten, dann sind wir leicht geneigt, uns auf uns selbst zurückzuziehen und aus der Gemeinschaft mit den anderen zu flüchten, um irgendwelche andere Befriedigungen und Tröstungen zu suchen. Wir können nicht wirklich aus eigener Kraft glauben, dass mit dem Kreuz auch die Auferstehung verbunden ist. Deshalb verlassen wir Jerusalem, den Ort des Kreuzes, der aber zugleich der Ort des Friedens für uns wäre, und suchen uns eine ‚warme Quelle‘, also das, was uns angenehmer erscheint. So geht es vielen Menschen, die zwar gläubig sind, aber angesichts des Kreuzes schwach werden und nicht wirklich an eine Auferstehung glauben.
Die Emmausgeschichte zeigt uns aber, dass der Herr die Seinen nicht verlässt. Die Tatsache, dass er unerkannt den Weg der Jünger mitgeht, ist ein Zeichen dafür, wie sehr er uns liebt und wie sehr er um uns besorgt ist. Er geht alle unsere Wege mit, sogar unsere Flucht- und Irrwege. Er geht aber als Lehrer mit den Menschen mit.
Es heißt: „Jesus legte ihnen dar, … was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.“ Er lehrt uns also tiefer zu verstehen, wer er selber ist, welchen Sinn Kreuz und Leiden in unserem Leben haben und was Auferstehung bedeutet. Freilich gilt für uns auch das, was über die Jünger gesagt wird: „Sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten.“ Es braucht oft lange, bis wir das alles begreifen. Aber wenn wir, wie diese beiden Jünger, auch nur ein wenig aufgeschlossen und nicht ganz verhärtet sind, so findet Jesus einen Zugang zu unserem Herzen, so dass es vom Licht und Feuer der Wahrheit entzündet wird. Die Jünger sagten: „Brannte nicht unser Herz.“
Es heißt weiter, dass den Jüngern die Augen aufgingen und sie Jesus erkannten, als er das Brot brach. Das ist ein Hinweis auf die Eucharistie. In der hl. Messe dürfen wir mit den Augen des Glaubens Jesus Christus erkennen und teilnehmen am Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung.
Wir empfangen hier seinen Heiligen Geist, durch den wir die Leiden, Mühen und Kreuze unseres Lebens mit Jesus vereinen, und darin auch die Auferstehung und den wahren Frieden finden. Wir erkennen, dass die ‚warmen Quellen‘ dieser Welt uns nicht die wahre Freude bringen können, sondern nur der auferstandene Herrn.