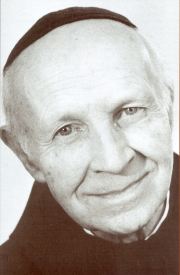60 Jahre Kriegsende – 50 Jahre österreichischer Staatsvertrag
60 Jahre Kriegsende – 50 Jahre österreichischer Staatsvertrag
Unser katholischer Glaube hält wesentlich daran fest, dass Gott mit seiner weisen Vorsehung dieser Welt und jeden Menschen regiert und lenkt. Er ist der Herr der Geschichte. Maria hatte in Gottes Heilsplan immer eine besondere Aufgabe. Das dürfen wir auch bei der Betrachtung der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht übersehen.
Am 13. Juli 1917 sagte Maria in Fatima zu den Kindern: “Ihr habt (in einer Vision) die Hölle gesehen, auf welche die armen Sünder zugehen. Um sie zu retten, will der Herr die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt einführen. Wenn man das tut, was ich sage, werden viele gerettet und der Friede wird kommen. Der Krieg geht seinem Ende entgegen; aber wenn man nicht aufhört, den Herrn zu beleidigen, wird nicht lange Zeit vergehen, bis ein neuer, noch schlimmerer beginnt. Wenn ihr in einer Nacht ein unbekanntes Licht sehen werdet, so wisset, es ist das Zeichen von Gott, dass die Bestrafung der Welt für ihre vielen Verbrechen nahe ist: Krieg, Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters … “
Der Ruf der Gottesmutter in Fatima wurde offensichtlich weitgehend überhört und so trat auch ein, was sie vorausgesagt hatte.
25./26. Jänner 1938: Am Abend dieses Tages bemerkt man über ganz Europa am nächtlichen Himmel ein außergewöhnliches Nordlicht. Sr. Lucia, die Seherin von Fatima, erklärt diese Lichterscheinung als das von Maria prophezeite Zeichen vom Himmel.
Bald darauf bricht der von den Nationalsozialisten Deutschlands angezettelte Krieg aus, der mit einem unvergleichlichen Siegeszug beginnt. Ein Land um das andere wird erobert, und nichts scheint diese antichristliche nationalsozialistische Macht aufhalten zu können. Der gesamte europäische Kontinent stand direkt oder indirekt unter der Macht jenes Mannes, der im Hinblick auf den sicher zu erwartenden erfolgreichen Ausgang des Krieges seinen Parteifunktionären zum voraus die Weisung erteilt hatte, als ersten Teil der Siegesfeier jeden katholischen Geistlichen auf dem Dorfplatz aufzuhängen.
Wie kam es aber zur Wende in diesem Krieg?
Hier tritt ein heilsgeschichtlicher Zusammenhang zutage, den man in den Geschichtsbüchern nicht findet. Papst Pius XII. hat sich in der äußersten Not des Krieges an das erinnert, was Maria in Fatima gesagt hat und weihte am 31. Okt. 1942 die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariä. Dieser Tag wird nun tatsächlich zum Wendepunkt im Kriegsgeschehen. Ein französischer Militärkritiker schrieb damals: “Auf allen Schlachtfeldern, in der Wüste Afrikas wie auf den vereisten Ebenen Rußlands treten die deutschen Armeen seit dem November 1942 den Rückzug an. Die Umkehr der Lage erfolgte plötzlich und fast gleichzeitig, von einem Ende der ungeheuren Schlachtlinie zum anderen. Dieser Charakter der Ereignisse hat alle Beobachter verblüfft.”
Es lässt sich aufzeigen, dass die entscheidenden Siege der Alliierten meist an Muttergottesfesten errungen wurden. So wurde durch die Hilfe Mariens die Zeit des Nationalsozialismus abgekürzt, jener Wahnideologie, die 50 Millionen Todesopfer gefordert hat.
Im Licht von Fatima müssen wir auch den Staatsvertrag und die Freiheit Österreichs sehen. Noch bis zum Februar 1955, 10 Jahre nach Kriegsende, schien es völlig aussichtslos, dass es einmal ein besatzungsfreies Österreich geben könnte. Nach der 268. Verhandlung zum Staatsvertrag sagte der sowjetische Außenminister Molotow in Berlin: „Herr Figl, machen sie sich keine Hoffnungen. Was wir Russen einmal haben, das geben wir nicht her.“
Und doch geschah das Wunder, dass Österreich aus dem Machtbereich des sowjetischen Kommunismus freikam. Und das war nicht nur das Ergebnis geduldiger Verhandlungen sondern auch eine Erfüllung der Verheißung Mariens in Fatima.
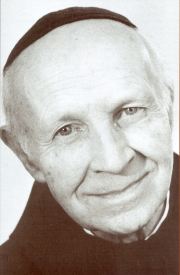
„Tut, was ich euch sage und ihr werdet Frieden haben!“ Diese Worte, die Pater Petrus Pavlicek in seinem Herzen vernahm, stam¬men aus der Botschaft von Fatima. Öfters betonte P. Petrus: „Was wäre geworden, wenn ich damals in Mariazell nicht auf diese Eingebung gehört hätte?“ Sein Gehorsam gegenüber der Einladung Mariens war offensichtlich grundlegend für die Entwicklung Österreichs zur Freiheit.
Der Fanziskanerpater Petrus Pavlicek hatte im Krieg eine Broschüre über die Erscheinungen in Fatima gelesen. Im Februar 1946 kam er nach Mariazell, um Maria für die glückliche Heimkehr aus dem Krieg zu danken. Er vertraute Maria auch die Not Österreichs an, und da hörte er in seinem Inneren die Antwort:
„Tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden haben.“ Im Februar 1947 gründete den Rosenkranz-Sühnekreuzzug (RSK). Er zog mit einer Fatimastatue durch ganz Österreich, um für diese Gebetsgemeinschaft zu werben.
1955 gehörten ihr 500.000 Mitglieder an, die den Rosenkranz beteten 1. zur Sühne für die vielen Beleidigungen Gottes, 2. um die Bekehrung der Sünder und 3. um Frieden und Rettung der Welt und die Freiheit Österreichs. Er rief auch zu monatlichen Sühnewallfahrten in der Franzisanerkirche in Wien auf, weiters wurden jährlich große Lichterprozessionen auf der Wiener Ringstraße abgehalten.
Mitte des Marienmonats, am Sonntag, 15. Mai 1955, wurde der Österreichische Staatsvertrag – nach 354 Verhandlungen – im Schloss Belvedere in Wien unterzeichnet. An diesem Tag fand in der Wiener Franziskanerkirche die 81. der monatlich abgehaltenen Sühneandachten des RSK statt. Das waren 9 x 9 (!) Sühneandachten oder neun Gebetsnovenen; ein offensichtliches Zeichen der Hilfe Mariens.