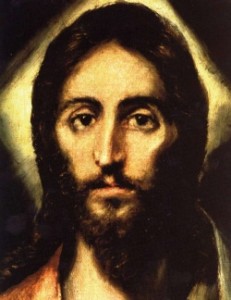Mutter Makaria (1927 – 1993) war eine der großen Sühneseelen, die Gott berufen hatte, Fürsprecherin für Russland zu sein. Sie war behindert, konnte nicht gehen, lag meist elend zusammengekrümmt auf ihrem Bett, führte ein Leben in erbärmlichsten Verhältnissen. Sie hat dieses Kreuz in größter Geduld getragen, unablässig gebetet und wurde so zur Trösterin tausender Menschen, die rat-, hilfe- und heilungsuchend zu ihr kamen.
Mutter Makaria (1927 – 1993) war eine der großen Sühneseelen, die Gott berufen hatte, Fürsprecherin für Russland zu sein. Sie war behindert, konnte nicht gehen, lag meist elend zusammengekrümmt auf ihrem Bett, führte ein Leben in erbärmlichsten Verhältnissen. Sie hat dieses Kreuz in größter Geduld getragen, unablässig gebetet und wurde so zur Trösterin tausender Menschen, die rat-, hilfe- und heilungsuchend zu ihr kamen.
Mutter Makaria (ihr Ordensname) wurde am 13. Juni 1926 im Dorf Karpovo geboren und auf den Namen Feodosia, „die von Gott Gegebene“ getauft.
Die Großfamilie Artemev, zu der insgesamt 20 Personen gehörten, bemerkte, dass es mit diesem Kind etwas Besonderes auf sich hatte. Eine Kerze, die über ihrer Wiege war, entzündete sich jeweils zu Mittag auf unerklärliche Weise von selbst und brannte bis drei Uhr nachmittags.
Die Kleine begann früh zu laufen, doch plötzlich mit eineinhalb Jahren konnte sie ihre Beine nicht mehr strecken. „Ab meinem dritten Lebensjahr konnte ich keinen Zentimeter mehr gehen und wurde für meine Familie zu einer einzigen Last.“ Kein Arzt konnte ihr helfen und in der Familie kümmerte sich kaum jemand um sie. „Sie hatten kein Mitleid mit mir und gaben mir nichts zu essen, in der Hoffnung, ich würde bald sterben. Ich wurde so schwach, dass ich kaum noch kriechen konnte. Ich weiß nicht, wie ich überlebte.“
Feodosias einziger äußerer Trost war es, wenn ihr Vater sie auf den Schoß nahm, während er aus der Heiligen Schrift vorlas. So wurde die innere, geistliche Welt, der vertraute Umgang mit Engeln und Heiligen, von dem niemand etwas ahnte, zu ihrer einzigen Freude.
Eines Morgens wachte die achtjährige Feodosia nicht auf. Sie war kalt und leblos. Rasch brachte der Vater sie ins Krankenhaus, wo die Ärzte nach der Untersuchung erklärten: „Wenn das Kind in 14 Tagen nicht aus dem komaartigen Schlaf erwacht, ist es wirklich tot.“ In dieser Zeit wurde sie aber in den Himmel entrückt. „Mir wurde auch eine riesige durchsichtige, goldene Kirche gezeigt. ‚Warum gibt es denn in dieser Kirche keine Ikonen?‘, fragte ich, worauf die Heiligen antworteten: ‚Weshalb Ikonen? Wir sind doch hier alle lebendig gegenwärtig!‘ Die Schönste unter allen war die Gottesmutter. Weinend flehte ich sie an: ‚Bitte heile meine Beine oder lass mich hierbleiben.‘ Doch die himmlische Zarin erwiderte: ‚Du kannst jetzt noch nicht bleiben, denn du wirst auf Erden noch gebraucht. Ich werde dich nie verlassen‘, versprach sie mir.“ Dann beschenkte die Gottesmutter sie mit dem Charisma der Heilung. Zum Schrecken aller kroch sie nach 14 Tagen aus der Totenkammer heraus.
In den Kriegswirren war ihre Familie und viele andere aus dem Dorf geflüchtet. Sie blieb allein zurück. Und als fremde Leute das Haus der Artemevs übernahmen, wurde Feodosia mitleidslos angewiesen: „Kriech ins Nachbardorf und bitte dort um ein Dach über dem Kopf!“ Aber auch in den anderen Dörfern gab es niemanden, der das verkrüppelte Mädchen mit dem zerrissenen Kleid und den blutenden Beinen aufnahm. Sie musste 700 Tage! im Freien verbringen. „So schleppte ich mich weinend in einen Schuppen und legte mich ins Heu. Im Winter grub ich mir manchmal ein Loch in den Schnee und verkroch mich zum Schlafen wie ein Tier darin. Ich trank schmutziges Wasser, aß eine Handvoll Schnee und Birkenbast oder im Sommer Beeren, Kräuter und Feldblumen, da mir nur selten jemand ein Stück Brot gab. Bei allem betete ich ununterbrochen zu Gott.“ 1943 sagte ihr die Gottesmutter dann: „Nun hast du lange genug auf der Straße gelebt. Jetzt sollst du ein Zuhause bekommen. Du wirst heute jemanden treffen.“ Tatsächlich nahm die 72-jährige Nonne Natalia, die von den Kommunisten aus ihrem Kloster vertrieben worden war, das Mädchen noch am selben Tag in ihr Haus in Tjomkino auf. Bis zum Tod Mutter Natalias hatte Feodosia es über 30 Jahre lang gut bei ihr. Ihr Charisma der Heilung und Seelenschau wurde immer mehr bekannt. Mit Autos, per Bus oder Zug kamen Russen, Ukrainer, Tataren und Zigeuner. Metropoliten suchten ebenso Hilfe wie einfache Gläubige, Juden, Atheisten und selbst Besessene.
Einmal fragte Makaria die Gottesmutter, die ihr oft erschien: „Mutter, warum hast du dir einen Krüppel wie mich ausgesucht?“ Da antwortete diese: „Ich habe mich überall umgesehen und keine Bessere gefunden als dich. Du bist die Auserwählte.“ ‑ „Ach, was für eine Auserwählte könnte ich schon sein? Mein Lebtag verbringe ich im Bett!“ ‑ „Ja, du bist meine Vollkommene.“ ‑ „Was du mit vollkommen meinst, verstehe ich nicht“, erwiderte Makaria, während sie sich ehrfürchtig vor der Gottesmutter verneigte, „aber die Leiden nehme ich gerne an. Leiden, das kann ich.“ Ein geistiger Sohn sagte: „Sie umfing mit ihren Leiden ganz Russland“, und Makaria vertraute diesem geistigen Sohn an: „Gott hat eine so nutzlose Person wie mich zum Leiden erschaffen. Man darf Ihn nicht beleidigen. Ich habe außer Ihm und meinem Bett nichts anderes gekannt. Noch lange werde ich hier liegen, Ihn anschauen und für alle leiden, so kann man hundert Jahre verbringen.“