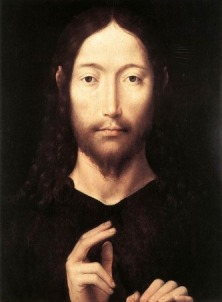Svetlana Alliluyeva (1926-2011) war die Tochter des kommunistischen Diktators Josef Stalin (1878-1953). Sie trat nach einem sehr bewegten Leben, das sie in drei Bänden beschreibt, 1982 in die katholische Kirche ein. Sie schrieb: „Ich wurde in die Arme der seligen Jungfrau Maria aufgenommen. … Wer könnte mein Fürsprecher sein außer der Mutter Jesu? Plötzlich zog sie mich an sich.“
Svetlana Alliluyeva (1926-2011) war die Tochter des kommunistischen Diktators Josef Stalin (1878-1953). Sie trat nach einem sehr bewegten Leben, das sie in drei Bänden beschreibt, 1982 in die katholische Kirche ein. Sie schrieb: „Ich wurde in die Arme der seligen Jungfrau Maria aufgenommen. … Wer könnte mein Fürsprecher sein außer der Mutter Jesu? Plötzlich zog sie mich an sich.“
„Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der nie über Gott gesprochen wurde. Aber als ich erwachsen wurde, stellte ich fest, dass es unmöglich ist, ohne Gott im Herzen zu leben.“ Josef Stalin selbst wuchs in der orthodoxen Kirche auf. Seine Eltern wollten eigentlich, dass er Priester wird. Aber unter dem Einfluss der kommunistischen Ideologie lehnte er das Christentum schließlich ganz ab. Während er an der Macht war, tat Stalin alles, um das Christentum auszurotten. Bei den Säuberungen von 1937 und 1938 wurden z.B. an die 170.000 russisch-orthodoxe Geistliche verhaftet und meist erschossen.
Die Mutter von Svetlana, die zweite Frau Stalins, war überzeugte Kommunistin. Von ihr hat Svetlana wenig Liebe erfahren. Als Svetlana sechs Jahre alt war, nahm sich ihre Mutter das Leben. Ihr Vater verehrte Svetlana sehr. Er war verspielt und liebevoll mit ihr solange sie ein Kind war. Und Svetlana erwiderte diese Liebe. Sie schaute zu ihrem Vater als einem weisen Helden auf.
Die Zweifel an ihrem Vater begannen, als sie bemerkte, dass nach dem Tod ihrer Mutter sogar die Verwandten ihrer Mutter verschwanden. Als sie mit 16 Jahren ihren ersten Freund nach Hause brachte, wurde er von ihrem Vater als Spion in den Gulag verbannt. So kam es zu einem Bruch in der Beziehung zu ihrem Vater. Als sie ihm als junge Frau mitteilte, dass sie heiraten wolle, sagte er: „Zum Teufel mit dir. Mach, was du willst.“ Er wollte seinen Schwiegersohn nicht einmal sehen. Im März 1953 starb Stalin. „Mein Vater starb einen schwierigen und schrecklichen Tod.“ Svetlana war tagelang an seinem Bett.
In ihrem weiteren Leben hat sie mehrmals geheiratet. Aber ihre Ehen scheiterten meist nach zwei, drei Jahren.
Auf ihrer Suche nach Gott empfing sie 1962 heimlich in der orthodoxen Kirche die Taufe. „Das Sakrament der Taufe besteht darin, das Böse, die Lüge, abzulehnen. … Ich glaubte, dass der Geist der Wahrheit stärker war als die materiellen Werte. Und als all dies in mein Herz eingedrungen war, verschwanden die Fetzen des Marxismus-Leninismus, die mir seit meiner Kindheit beigebracht worden waren, wie Rauch.“
1966 gelang es ihr, aus der UdSSR auszureisen und in den USA Asyl zu erhalten. Mit ihren Büchern und Vorträgen erlangte sie als Tochter Stalins eine gewisse Berühmtheit. Aber in ihrem persönlichen Leben fand sie keine Erfüllung. In den USA lernte sie Pater Giovanni Garbolino kennen, der früher in Russland als Missionar gewirkt hatte. Durch ihn wurde sie tiefer in den katholischen Glauben eingeführt und sie konvertierte am 13. Dez. 1982 zur katholische Kirche.
Swetlana schrieb über ihre Bekehrung: „Erst jetzt verstehe ich die wunderbaren Gnaden, die die Sakramente der Buße und der Heiligen Eucharistie bewirken. Früher war ich nicht bereit zu vergeben und zu bereuen, und ich war nie in der Lage, meine Feinde zu lieben. Aber seit ich jeden Tag zur hl. Messe gehe, fühle ich mich ganz anders als früher. … Die Eucharistie hat mir Leben gegeben.“ Am Ende starb sie nicht im Zorn auf die Welt, wie es ihr Vater getan hatte, sondern 2011 starb sie friedlich in einem Pflegeheim in Wisconsin mit 85 Jahren.