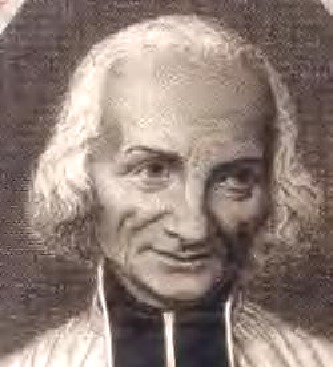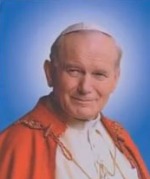Der 13. November 2011 ist für unsere Diözese ein großer Tag. Provikar Dr. Carl Lampert wird als Märtyrer des Glaubens seliggesprochen. Die Feier der Seligsprechung wird in Dornbirn in der Pfarrkirche St. Martin um 16.30 sein. Carl Lampert war ein großer Glaubenszeuge in einer schwierigen Zeit und er wird uns durch sein Beispiel und seine Fürsprache helfen, dass auch wir in den Verwirrungen unserer Zeit treu den Weg des katholischen Glaubens gehen.
Der 13. November 2011 ist für unsere Diözese ein großer Tag. Provikar Dr. Carl Lampert wird als Märtyrer des Glaubens seliggesprochen. Die Feier der Seligsprechung wird in Dornbirn in der Pfarrkirche St. Martin um 16.30 sein. Carl Lampert war ein großer Glaubenszeuge in einer schwierigen Zeit und er wird uns durch sein Beispiel und seine Fürsprache helfen, dass auch wir in den Verwirrungen unserer Zeit treu den Weg des katholischen Glaubens gehen.
Carl Lampert stammt aus Göfis, wo er am 9. Januar 1894 als jüngstes von sieben Kindern zur Welt kam. Seine Familie lebte in einfachen Verhältnissen. Nach der Matura trat er 1914 in das Priesterseminar in Brixen ein. Dort fiel der Student aus Vorarlberg vor allem durch sein feines Wesen, seine freundliche Art und sein elegantes Äußerliches auf. Am 12. Mai 1918 empfing er die Priesterweihe.
Seine erste Dienststelle trat Carl Lampert als Kaplan in Dornbirn-Markt an. Hier suchte er vor allem in vielen Vereinen den Kontakt zu den Jugendlichen, die er auch in verschiedenen Schulen unterrichtete. 1930 wurde er vom Bischof zum Studium des Kirchenrechts nach Rom gesandt. Die Zeit in Rom war für ihn, wie er später sagte, die glücklichste Zeit. 1939 – während der Herrschaft der Nationalsozialisten – wurde Dr. Carl Lampert zum Provikar der neuen errichteten Administratur Innsbruck-Feldkirch ernannt. Mit großem Verantwortungsbewusstein setzte er sich für kirchliche Anliegen ein.
Der Innsbrucker Gauleiter Franz Hofer hatte sehr bald erkannt, dass er in Lampert den gefährlichsten kircheninternen Gegner hatte, den er beseitigen wollte. Provikar Lampert trat sehr mutig und entschieden gegen kirchenfeindliche Handlungen der örtlichen nationalsozialistischen Gauleitung auf und verteidigte die Rechte der Kirche. Mehrmals wurde er dafür in Gestapo-Haft genommen. Der Fall des Pfarrers von Götzens, Otto Neururer, der am 30. Mai 1940 in Buchenwald ermordet wurde, brachte ihn schließlich selbst ins Konzentrationslager. Provikar Lampert hatte eine Todesanzeige für Pfarrer Neururer verfasst, die den Nationalsozialisten nicht passte.
Der Leidensweg Carl Lamperts führte ihn ab 25. August 1940 durch die Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen-Oranienburg und wiederum Dachau. Dort wurde er am 1. August 1941 entlassen, erhielt aber in Tirol „Gauverbot“ und musste sich fortan im Gau Pommern/Mecklenburg aufhalten. Dahinter steckte ein ausgeklügelter Plan, Lampert mittels eines Spitzels der Spionage zu überführen und sein Todesurteil vorzubereiten. Dieser Spitzel schleuste sich als „Ing. Hagen“ ein und sammelte fortan das Material für den Prozess. Sein Lügenprotokoll war Grundlage der Anklage gegen Provikar Carl Lampert und führte zu einem dreimaligen Todesurteil, das schließlich am 13. November 1944 vollstreckt wurde. Er wurde mit dem Fallbeil enthauptet. Seine letzen Worte unmittelbar vor der Hinrichtung waren „Jesus, Maria“.
Provikar Lampert musste in den Gefängnissen Schlimmes durchmachen, aber er war bis zuletzt getragen von einem tiefen Gottvertrauen. An seinen Bruder Julius schrieb er im Sept. 1944: „Nun ist mein Trost und meine Stärke Matthäus 5,11: ‚Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen und alles Böse fälschlich wider euch aussagen um meinetwillen. . . .‘ Wie lange ich noch lebend zu erreichen bin, weiß ich nicht, es kann auch schnell gehen. Alles steht in Gottes Hand, auf ihn vertraue ich, seinen Willen erfüllen will ich und bin bereit – auch zum Letzten! Nun ist alles noch ein Wettlauf der Zeit mit dem Tode – und ‚irgend eine Erlösung naht!'“
Mein letzter Atemzug sei ein inniger Dank
Am 8. April 1943 verfasste Dr. Lampert in Stettin sein Testament. Auch sein Letzter Wille beginnt damit, dass er Gott dankt für all die Liebe, die er in seinem Leben spüren konnte:
„Mein irdisches Leben übergebe ich meinem Gott und Schöpfer, wann und wie immer er es von mir fordern wird, meiner unsterblichen Seele möge er durch Christi Erlösungstat ein barmherziger Richter und Vater sein. Mein letzter Atemzug noch sei ein inniger Dank an den hl. dreieinigen Gott, für alle Gaben und Wohltaten meines ganzen Lebens, namentlich aber für das große Geschenk eines katholischen Elternhauses und der Auserwählung zum Kinde Gottes und Berufung zum Priestertum – Christ und Priester zu sein, war mein höchstes Glück, es leider nur so menschlich-armselig gewesen zu sein, mein tiefstes Leid …“
Zwei Wochen vor seinem Tod schrieb Provikar Lampert an seinen Freund Alfons Rigger; es war der Vorabend zum Christkönigssonntag, und er formulierte noch einmal sehr eindringlich seine gläubige Zuversicht:
„Doch es hat keinen Sinn, sich über die Existenz des Teufels zu unterhalten, wo er so reichlich zu erleben ist! Noch mag er triumphieren, niemals aber wird er siegen! – Christkönigstag heute, wie leuchtet sein Reich auf im Dunkel dieser entsetzlichen Zeit … immer mehr wollen wir ihm zugehören, immer tiefer und treuer, damit wir seines Reiches glückselige Herrlichkeit einst miteinander bei ihm genießen dürfen…“