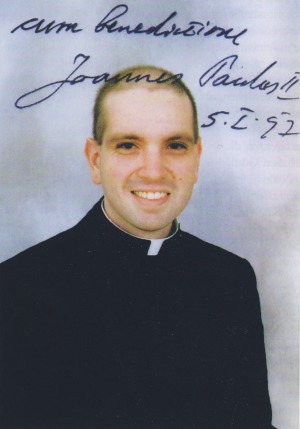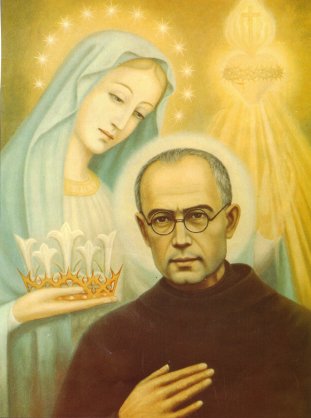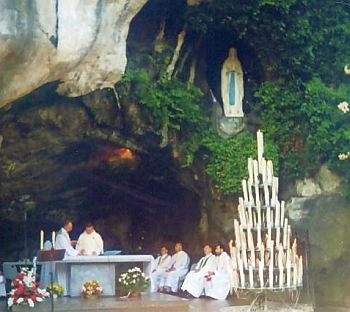Vor 100. Jahren geschah eines der außergewöhnlichsten Wunder, die die hl. Theresia von Lisieux gewirkt hat. Dieses Wunder, das 1910 im Karmelkloster von Gallipoli in Italien geschah, war für die Kirche einerseits die Be-stätigung ihres „kleinen Weges“ und es hat auch den Weg zur Seligsprechung von Theresia geebnet.
Vor 100. Jahren geschah eines der außergewöhnlichsten Wunder, die die hl. Theresia von Lisieux gewirkt hat. Dieses Wunder, das 1910 im Karmelkloster von Gallipoli in Italien geschah, war für die Kirche einerseits die Be-stätigung ihres „kleinen Weges“ und es hat auch den Weg zur Seligsprechung von Theresia geebnet.
Am 12. Juli 1897, als die hl. Theresia dem Tode nahe war, sagte die Priorin (ihre leibliche Schwester) zu ihr: „Du wirst vom Himmel auf uns herabschauen, nicht wahr?“ Theresia aber sagte überraschend: „Nein, ich werde herunterkommen.“ Und sie hat ihr Wort gehalten.
Bald nach ihrem Tod wurde Theresia bekannt durch ihre Autobiographie „Geschichte einer Seele“. 1908 erfuhr auch die Priorin des Karmels von Gallipoli, Mutter Maria Carmela vom Herzen Jesu, etwas über Theresia. Die Priorin war genauso alt wie Theresia und hatte mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ihre Klostergemeinschaft bekam die Wirtschaftskrise zu spüren. 1910 war das Kloster dem Ruin nahe. Es war mit 300 Lire verschuldet; damals eine beträchtliche Summe. Mutter Maria Carmela war zuversichtlich, dass ihr die kleine Therese helfen würde.
In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 1910 erschien ihr im Traum eine junge Karmeliten-Schwester. Sie lächelte ihr zu und forderte sie auf, ihr in das Zimmer zu folgen, in dem sich die Geldkassette mit dem Schuldschein befand: „Der Herr bedient sich der Seelen im Himmel ebenso wie der auf Erden“, sagte sie. „Hier hast du 500 Lire; damit kannst du die Schulden deiner Gemeinschaft bezahlen.“ Mutter Maria Carmela meinte, dass es die Gottesmutter sei: „Nein, meine Tochter, ich bin nicht unsere himmlische Mutter, sondern die Dienerin Gottes, Sr. Therese von Lisieux.“ Mit diesem Titel „Dienerin Gottes“ hat sie schon auf den Prozess zur Seligsprechung hingewiesen, der im selben Jahr eingeleitet wurde. Als ihr Theresia das Geld gegeben hatte und sich anschickte zu gehen, hielt sie die Priorin zurück sagte zu ihr: „Wartet, Ihr könntet Euch verirren.“ Doch sie antwortete mit einem engelsgleichen Lächeln: „Nein, meine Tochter, mein Weg ist sicher, ich habe mich nicht verirrt!“ Damit deutete sie an, dass der Weg der Kindschaft, den sie gelehrt hat, ein sicherer Weg zur Heiligkeit ist.
Am Morgen danach wurde zum Erstaunen der gesamten Gemeinschaft in der Geldkassette ein neuer 500-Lire-Schein gefunden.
Quelle: „30Tage“/Mai 2010