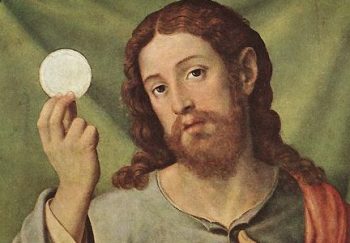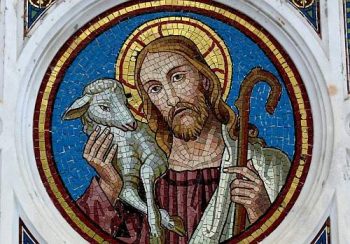Sophia Kuby (geb. 1981) ist die Tochter von Gabriele Kuby. Sie hat mit 17 Jahren (1998) eine besondere Bekehrungsgnade durch die Eucharistie empfangen, sie wurde mit 18 Jahren katholisch getauft und ist heute bei der Menschenrechtsorganisation ADF International in Wien tätig. Beim Eucharistischen Kongress 2021 in Budapest gab sie vor 15000 Jugendlichen Zeugnis über ihren Glaubensweg und hat in einem Interview mit Radio Horeb über ihre Bekehrung gesprochen. Sophia erzählt, dass der Glaube in ihrer Familie kein Thema war, aber sie spürte schon von Kindheit an eine Sehnsucht nach einem ‚Mehr‘, das sie durch nichts erfüllen konnte.
Sophia Kuby (geb. 1981) ist die Tochter von Gabriele Kuby. Sie hat mit 17 Jahren (1998) eine besondere Bekehrungsgnade durch die Eucharistie empfangen, sie wurde mit 18 Jahren katholisch getauft und ist heute bei der Menschenrechtsorganisation ADF International in Wien tätig. Beim Eucharistischen Kongress 2021 in Budapest gab sie vor 15000 Jugendlichen Zeugnis über ihren Glaubensweg und hat in einem Interview mit Radio Horeb über ihre Bekehrung gesprochen. Sophia erzählt, dass der Glaube in ihrer Familie kein Thema war, aber sie spürte schon von Kindheit an eine Sehnsucht nach einem ‚Mehr‘, das sie durch nichts erfüllen konnte.
„Ich bin ganz unerwartet eingeladen worden zu einer Großveranstaltung mit vielen Menschen, Bischöfen und Priestern, ich war damals 17. Es war bezeichnenderweise ein Pfingstsonntag. Aber das alles hat mir nichts gesagt, ich war nicht getauft und überhaupt nicht christlich sozialisiert. Ich wusste von der hl. Messe nur so viel, dass ich nicht zur hl. Kommunion gehen durfte. Meine Mutter, die sich zwei Jahre vorher zum katholischen Glauben bekehrt hatte, hat mir aber gesagt, ich dürfte bei der Kommunion mit überkreuzten Händen nach vorne gehen und mich segnen lassen. Und das habe ich dann gemacht, weil ich dachte, warum nicht, das kann ja nicht schaden. Und dann bin ich hingegangen mit überkreuzten Armen. Aber der Priester wollte mir die hl. Kommunion geben. Da stand ich perplex vor ihm und habe ihm das gesagt, ich gehöre nicht dazu, ich darf nicht kommunizieren. Da sagte der Priester zu mir: ‚Glaubst du, dass das Jesus Christus ist?‘ Und er hat mir die hl. Hostie vor die Augen gehalten. Da ist alles um mich herum verschwunden, da waren nur mehr diese kleine Hostie und ich. Und da durfte ich Ja sagen. Eine unglaubliche Gnade erfasste mich, die mich heute noch bis zu Tränen rührt, wenn ich daran denke – einundzwanzig Jahre danach. Es ist einfach die Kraft der Eucharistie. Sie kann ein Leben wirklich von null auf hundert verändern. Alles, was man ersehnt, ist in der Eucharistie gegenwärtig.“
„Es wurde mir geschenkt zu glauben und zwar mit einer Gewissheit, die man sich nicht selbst machen, die man sich nicht einreden kann. Und ich habe gesagt: Ja, ich glaube. Das war mein erstes Glaubensbekenntnis. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Das war so stark, dass ich mit zitternden Beinen zurück auf meinen Platz bin, denn ich war gerade einer so großen Liebe begegnet, die ich davor in meinem Leben nicht kannte. Jede noch so große menschliche Liebe ist nicht vergleichbar damit. Danach war nichts mehr wie davor. In den Wochen vor dem Bekehrungserlebnis habe ich eine ganz extreme Leere gespürt – in meinen Freundschaften, in meinem sozialen Umfeld. Außen war alles wunderbar, aber innen war ein Hunger und ein Durst nach mehr.
Auf einmal hatte ich den Glauben und ich wusste, da ist ein Weg, dem ich folgen will. Danach kam das Jahr der Vorbereitung auf die Taufe und ich habe gelernt, was die Kirche eigentlich sagt. Das war eine interessante Zeit, ich habe eine neue Welt entdeckt.
Menschlich war es auch eine harte Zeit der Einsamkeit, weil manche Freunde nicht verstanden haben, dass sich meine Prioritäten geändert haben. Es braucht eine gewisse Übergangszeit, in der man sein Leben neu ordnet. Aber ich wusste, Gott lässt mein Leben nicht in diesem Zustand, sondern er schenkt mir alles in Fülle zurück. Ich wusste, er wird mir die besten Freunde schenken, er wird mein Leben wirklich reich machen. Und ich habe in diesen Jahren keinen Moment mehr gezweifelt.“